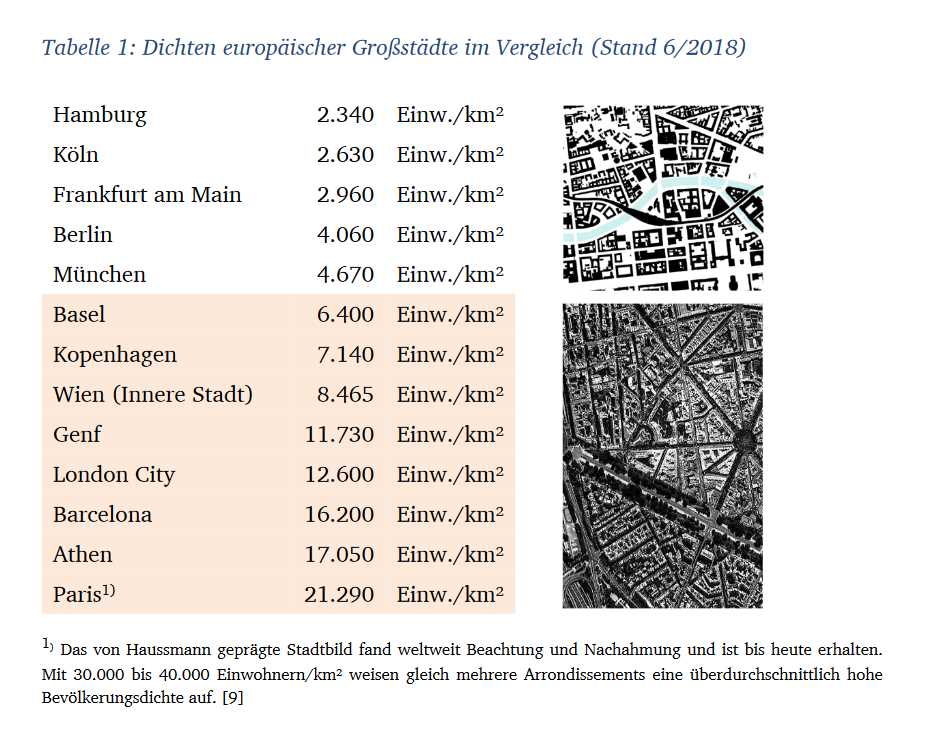Die Mehrheit der bürgerlichen Parteien in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung steht hinter dem Projekt Garnisonkirche!
Pfarramt, Stiftung und Fördergesellschaft und viele ehrenamtlich engagierte Bürger haben seit Jahren dafür gearbeitet.
Endlich hat der Bau nun begonnen und der Turm wächst, begrüßt von einem großen Teil der Stadtbevölkerung – und was macht der Oberbürgermeister?
Er geht auf Distanz!?
Er verzichtet auf seinen Kuratoriumssitz und damit auf die wichtige Stimme der Stadt bei dem größten und bedeutendsten Bauprojekt Potsdams. Unverständlich! Denn die fadenscheinigen Begründungen dafür haben auch ein Jann Jacobs nicht abgehalten, den Platz im Kuratorium einzunehmen. Das alles mutet sehr nach Wahlkampf an.
Hier ein bisschen Zucker für das bürgerliche Lager inclusive Mitteschön mit der Liebeserklärung an den Stadtkanal (wobei hier versprochene Aktivitäten schon lange ausstehen). Jetzt ein bisschen Zucker für die Linken und die ANDERE. Auch die Ehrung von Lutz Boede und die schwammige Beruhigung der Künstler im Rechenzentrum deuten darauf hin, dass nur beruhigt werden soll.
Wir wissen um seinen Ansatz der „Versöhnung“ der zerrissenen Stadtgesellschaft, die er betreiben will.
Das ist löblich, doch wo ist hier was „zerrissen“?
Ja hier wird diskutiert und gestritten, was in einer Stadt normal ist. Es gibt dabei auch unterschiedliche Meinungen, die niemals einen Konsens finden werden, das muss man auch mal akzeptieren können. Denn bekanntlich kann man es nicht allen Recht tun.
Jahrelanges Diskutieren oder Workshops, die horrende Steuergelder verschlingen und nur bedingt fruchtbringend sind, sind kein Ersatz für eigenes verantwortungsvolles Handeln.
Wir erwarten von unserem OB, nicht alles über den Haufen zu schmeißen, was mühsam errungen wurde.
Wir erwarten von ihm eine eigene konstruktive Gestaltungskraft für die Stadt!

Mike Schubert Quelle: MAZ Bernd Gartenschläger